Wer an Cannabis als Rauschmittel denkt, hat meist THC im Kopf, den Hauptwirkstoff, der für den berauschenden Effekt verantwortlich ist. Doch die Cannabispflanze ist chemisch gesehen weitaus komplexer: In Blüten lassen sich mehr als 500 verschiedene Inhaltsstoffe nachweisen – darunter über 100 Cannabinoide, mehr als 150 Terpene sowie zahlreiche Flavonoide, Alkohole, Ester und weitere organische Verbindungen [1].
Diese Vielfalt macht die Cannabis-Wirkung einzigartig. Denn nicht allein die Menge an THC entscheidet darüber, wie sich ein Rausch anfühlt, sondern vor allem das Zusammenspiel der Inhaltsstoffe. Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang vom sogenannten Entourage-Effekt: Cannabinoide, Terpene und andere Substanzen wirken nicht isoliert, sondern beeinflussen sich gegenseitig und prägen gemeinsam das Gesamterlebnis [2].
Genau deshalb können zwei Blüten mit nahezu identischem THC-Gehalt völlig unterschiedliche Effekte haben. Während die eine eher „kopflastig“ und anregend wirkt, entfaltet die andere eine schwere, körperbetonte Wirkung. Ursache ist das individuelle Wirkstoffprofil, das wie ein Fingerabdruck jeder Sorte ihre ganz eigene Charakteristik verleiht [3].
Für Konsument:innen bedeutet das: Wer Cannabis nur nach dem THC-Gehalt beurteilt, greift zu kurz. Erst der Blick auf das gesamte chemische Zusammenspiel erklärt, warum sich manche Sorten besser für gesellige Abende eignen, während andere vor allem zum Entspannen und Abschalten passen.
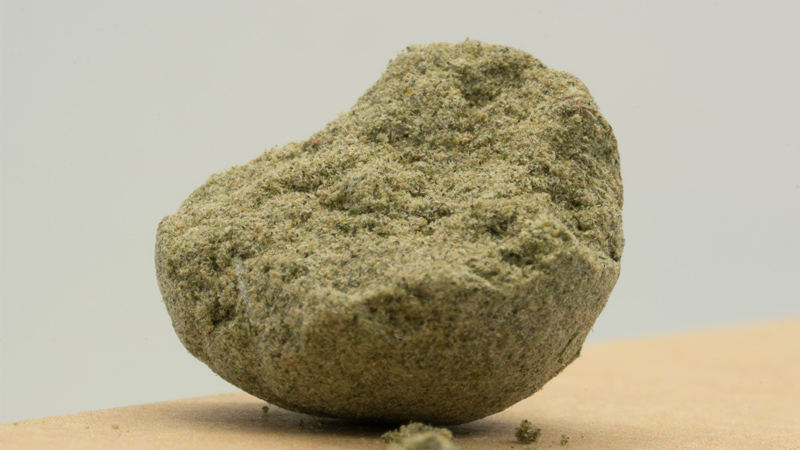
Cannabis-Wirkung: Psychoaktive Cannabinoide
Treibende Kraft der Cannabis-Wirkung sind die psychoaktiven Cannabinoide. Sie binden an Rezeptoren des körpereigenen Endocannabinoid-Systems (CB1 und CB2) und beeinflussen dadurch Stimmung, Wahrnehmung und Körperempfinden [4].
THC – der Hauptwirkstoff des „High“
Das bekannteste Cannabinoid ist Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC). Typisch sind Gefühle von Euphorie, gesteigerter Kreativität, veränderter Zeitwahrnehmung sowie eine intensivere Wahrnehmung von Musik, Farben und Geschmack [5]. Mit steigender Dosis können allerdings auch Effekte wie Paranoia, Gedankensprünge oder motorische Verlangsamung auftreten.
CBD – der Gegenspieler im Hintergrund
Cannabidiol (CBD) der Cannabispflanze wirkt selbst nicht berauschend, beeinflusst aber die Art des Rausches. Es kann die Überaktivierung durch THC abmildern und führt zu einem klareren, „geerdeten“ High. Blüten mit einem ausgewogenen THC/CBD-Verhältnis werden von vielen Konsument:innen als angenehmer und weniger „dröhnend“ empfunden [6].
Weitere Cannabinoide: kleine Akzente im Gesamtbild
Neben THC und CBD sind auch CBG, CBN und THCV interessant. Sie wirken im Vergleich zwar deutlich schwächer, können aber die Rauscherfahrung subtil modulieren:
- CBG (Cannabigerol): wird teils mit einem fokussierteren Effekt in Verbindung gebracht.
- CBN (Cannabinol): entsteht durch den Abbau von THC und wirkt oft eher sedierend [19]– ein Grund, warum ältere Blüten oft „müder“ machen.
- THCV (Tetrahydrocannabivarin): kann in niedrigen Dosen den THC-Rausch dämpfen, in höheren Dosen aber sogar selbst psychoaktive Wirkungen entfalten [7].
Decarboxylierung
In der frischen Pflanze liegen Cannabinoide überwiegend in inaktiver Säureform vor (z. B. THCA, CBDA). Erst durch Hitze oder längere Lagerung werden sie durch einen chemischen Prozess – die Decarboxylierung – in ihre aktive Form umgewandelt [19].
Das erklärt, warum Cannabis beim Rauchen, Verdampfen oder Backen seine Wirkung entfaltet, beim reinen Verzehr frischer Blüten hingegen kaum spürbar ist.
Terpene – der unterschätzte Regisseur
Während THC und andere Cannabinoide den „Motor“ der Wirkung bilden, übernehmen die Terpene die Rolle des Regisseurs. Sie bestimmen nicht nur Geruch und Geschmack der Blüte, sondern modulieren auch spürbar den Rausch. Viele Konsument:innen berichten, dass sich Blüten mit gleichem THC-Gehalt völlig unterschiedlich anfühlen – verantwortlich dafür ist oft die Terpenzusammensetzung [8].
Beispiele für typische Terpene und ihre Wirkung im Rausch
- Myrcen: Häufig in vielen Sorten vertreten. Konsument:innen erleben den Rausch oft als „schwer“ und körperlich, manchmal fast couchlock-artig [9].
- Limonen: Verleiht Zitrusaromen. Es wird mit einem helleren, anregenden und stimmungsaufhellenden High in Verbindung gebracht – beliebt bei Sorten, die eher euphorisch wirken [10].
- β-Caryophyllen: Würzig, pfeffrig. Viele berichten von einem entspannenden, stresslösenden Effekt, der den THC-Rausch „runder“ macht. Besonderheit: Caryophyllen bindet direkt an den CB2-Rezeptor, was es von anderen Terpenen unterscheidet [11].
- Pinen: Riecht frisch nach Wald und Kiefer. Es kann ein klareres, wacheres High unterstützen und soll dabei helfen, den „benebelten“ Effekt von THC etwas abzumildern [12].

Terpenprofile als „Duftsignatur“ einer Sorte
Jede Sorte hat ihr eigenes Terpenprofil – eine Art chemischer Fingerabdruck. Dieses Profil entscheidet, ob eine Blüte eher entspannend, kreativitätsfördernd oder belebend wirkt. Für Konsument:innen sind Terpene deshalb weit mehr als nur Duftstoffe: Sie liefern wertvolle Hinweise darauf, was für ein Rauscherlebnis eine Sorte wahrscheinlich hervorrufen wird.
Flavonoide und andere Verbindungen
Neben Cannabinoiden und Terpenen enthält die Cannabisblüte eine Vielzahl weiterer Stoffe, die weniger bekannt, aber nicht minder spannend sind. Diese „stillen Begleiter“ wirken nicht isoliert stark psychoaktiv, können aber das Gesamterlebnis abrunden.
Farbe, Geschmack, Wirkungstiefe
Flavonoide sind pflanzliche Farbstoffe, die man auch aus Obst und Gemüse kennt. Einige Flavonoide wie die sogenannten Cannaflavine sind einzigartig für Cannabis und könnten die Tiefe des Rauscherlebnisses subtil mitgestalten [13].
Viele Konsument:innen beschreiben, dass Sorten mit besonders intensiver Farbe oder Aroma auch ein „volleres“ Erlebnis vermitteln – wissenschaftlich eindeutig belegt ist das bislang aber nicht.
Weitere Verbindungen – kleine Moleküle, großer Unterschied
Neben den Hauptgruppen wurden in Cannabis auch Alkohole, Ester, Ketone und Aliphate nachgewiesen [14]. Diese treten nur in sehr geringen Mengen auf, prägen aber feine Geschmacksnoten – ähnlich wie beim Wein die Nuancen zwischen zwei Rebsorten.
- Ester tragen fruchtige, süßliche Aromen bei.
- Alkohole verstärken pflanzliche, manchmal scharfe Noten.
- Aliphatische Verbindungen liefern erdige, manchmal fast dieselartige Untertöne.
Allerdings ist ihr direkter Einfluss auf die Cannabis-Wirkung noch nicht abschließend geklärt.
Die „feine Abstimmung“
Während THC, CBD und Terpene den Hauptton angeben, sorgen Flavonoide und diese kleineren Stoffgruppen für die „Feinabstimmung“. Sie sind es, die zwei Sorten mit vergleichbarer Cannabinoid- und Terpenzusammensetzung dennoch unterschiedlich wirken und schmecken lassen können.
Entourage-Effekt
Wie anfangs erwähnt, wird die Wirkung von Cannabis nicht durch einen einzelnen Stoff bestimmt, sondern durch das Zusammenspiel vieler Moleküle. Cannabinoide, Terpene und Flavonoide agieren wie ein Orchester: THC mag die erste Geige spielen, doch erst das Zusammenspiel aller Instrumente erzeugt die volle Symphonie [15].
Mehr als die Summe der Teile
Eine Blüte mit 20 % THC kann völlig unterschiedlich wirken – je nachdem, welche Terpene und Begleitstoffe sie enthält. Während ein myrcenreicher Strain eher „couch-lock“-Effekte (körperlich schwer, sedierend) hervorrufen kann, sorgt limonenbetonte Genetik mit identischem THC-Gehalt für ein leichteres, euphorischeres High [16].
Beispiel: THC + CBD
CBD gilt oft als Gegenspieler zu THC: Es dämpft psychoaktive Überlastung und kann das High „klarer“ und kontrollierter wirken lassen. Für viele Konsument:innen ist genau dieses Zusammenspiel entscheidend, ob ein Erlebnis angenehm oder überfordernd wirkt.
Bedeutung für den Anbau im Club
Für den Cannabis Club bedeutet das: Sorten sollten nicht allein nach THC-Gehalt ausgewählt werden. Ein differenzierter Blick auf das Gesamtprofil – Cannabinoide und Terpene – ist für Konsistenz und Qualität beim Grow unverzichtbar. Mitglieder profitieren, wenn sie nicht nur nach Prozentzahlen, sondern nach Wirkungstypen wählen können: z. B. „aktivierend & klar“ versus „beruhigend & tief“.
Der Entourage-Effekt ist damit ein realer Mechanismus, der erklärt, warum Cannabis-Erlebnisse so individuell und nuanciert sind [17].

Genetik, Anbau und Nachernte – warum jede Blüte einzigartig ist
Genetik – das Grundprogramm der Pflanze
Die Genetik einer Sorte legt fest, welche Cannabinoide und Terpene die Pflanze überhaupt bilden kann. Manche Genotypen besitzen Enzyme, die vor allem THCA synthetisieren, andere setzen Schwerpunkte auf CBD oder seltenere Cannabinoide wie CBG [18]. Ebenso entscheidet die genetische Ausstattung darüber, ob eine Pflanze eher fruchtige, erdige oder würzige Terpenmuster ausbildet.
Kurz gesagt: Die Genetik ist das Potenzial, der Anbau im Cannabis Club entscheidet, wie viel davon ausgeschöpft wird.
Steuerung der Wirkstoffproduktion
Die Kulturbedingungen beeinflussen maßgeblich, wie stark das genetische Potenzial zur Entfaltung kommt:
- Licht: Intensität und Spektrum steuern die Cannabinoidproduktion. Blauanteile fördern vegetatives Wachstum, Rotanteile die Blütenbildung.
- Klima: Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Terpensynthese. Zu hohe Temperaturen können flüchtige Terpene „verkochen“ [19].
- Nährstoffe: Überdüngung mit Stickstoff kann die Terpenbildung hemmen, während ausgewogene Ernährung die Pflanze in Richtung voller Aromaprofile steuert.
Bewahrung oder Verlust von Qualität
Selbst die beste Genetik und der perfekte Anbau verlieren an Wert, wenn die Ernte und anschließende Prozesse nicht stimmen:
- Trocknung: Zu schnelle Trocknung zerstört Terpene und macht das High kratzig und flach. Langsame Trocknung bei 18–22 °C und 45–55 % rF erhält Aromen und Wirkung.
- Curing: Durch kontrolliertes Nachreifen in Gläsern baut die Pflanze Restchlorophyll ab und rundet das Aroma ab. Viele Konsument:innen empfinden das High danach als weicher und klarer.
- Lagerung: Licht, Sauerstoff und Hitze beschleunigen den Abbau von THC (→ CBN) und Terpenen. Folge: das Gras wirkt milder, aber auch sedierender [20].
Genetik, Anbau und Nachernte bestimmen folglich gemeinsam das Erleben – und erklären, warum Cannabis so facettenreich bleibt.
Verwendete Quellen:
[1] ElSohly MA, Slade D. Chemical constituents of marijuana: The complex mixture of natural cannabinoids. Life Sci. 2005;78(5):539-48.
[2] Russo EB. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. Br J Pharmacol. 2011;163(7):1344-64.
[3] Hazekamp A, Tejkalová K, Papadimitriou S. Cannabis: From cultivar to chemovar II—A metabolomics approach to cannabis classification. Cannabis Cannabinoid Res. 2016;1(1):202-15.
[4] Howlett AC, Barth F, Bonner TI, Cabral G, Casellas P, Devane WA, et al. International Union of Pharmacology. XXVII. Classification of cannabinoid receptors and ligands. Pharmacol Rev. 2002;54(2):161-202.
[5] Iversen L. The Science of Marijuana. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2008.
[6] Englund A, Morrison PD, Nottage J, Hague D, Kane F, Bonaccorso S, et al. Cannabidiol inhibits THC-induced psychosis-like effects in humans. Neuropsychopharmacology. 2013;38(9):1675-84.
[7] Pertwee RG. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Δ⁹-THC, cannabidiol and Δ⁹-THCV. Br J Pharmacol. 2008;153(2):199-215.
[8] Booth JK, Bohlmann J. Terpenes in Cannabis sativa – From plant genome to humans. Plant Sci. 2019;284:67-72.
[9] Surendran S, Qassadi F, Surendran G, Lilley D, Heinrich M. Myrcene – A naturally occurring monoterpene: A review. Heliyon. 2021;7(9):e07835.
[10] Komiya M, Takeuchi T, Harada E. Lemon oil vapor causes an anti-stress effect via modulating the autonomic nervous system. J Agric Food Chem. 2006;54(15):5509-12.
[11] Gertsch J, Leonti M, Raduner S, Racz I, Chen JZ, Xie XQ, et al. Beta-caryophyllene is a dietary cannabinoid. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105(26):9099-104.
[12] Chen W, Vermaak I, Viljoen A. Camphor – A fumigant during the Black Death and a coveted fragrant wood in ancient Egypt and Babylon – A review. Fitoterapia. 2015;112:205-15.
[13] Werz O, Seegers J, Schaible AM, Weinigel C, Barz D, Koeberle A. Cannflavins from Cannabis sativa and their potential anti-inflammatory properties. Phytochemistry. 2014;102:7-14.
[14] Lewis MA, Russo EB, Smith KM. Pharmacological foundations of cannabis chemotypes: analytical chemistry and its role in the cannabis industry. Anal Chem. 2017;89(1):519-29.
[15] Russo EB, Marcu J. Cannabis pharmacology: The usual suspects and a few promising leads. Adv Pharmacol. 2017;80:67-134.
[16] Hazekamp A. The trouble with terpenes: Variability and pharmacology of terpenes in cannabis. Cannabis Cannabinoid Res. 2018;3(1):239-45.
[17] Danziger N, Bernstein N. Light matters: Effect of light spectrum on secondary metabolites in cannabis plants. Front Plant Sci. 2021;12:827133.
[18] Vergara D, Bidwell LC, Gaudino R, Torres A, Du G, Ruthenburg TC, et al. Genetic and chemotypic diversity in commercial cannabis. bioRxiv. 2019. doi:10.1101/592725.
[19] Zamengo L, Frison G, Bettin C, Sciarrone R, Serpelloni G. Stability of THC and CBD in dried cannabis flowers stored under different conditions. Forensic Sci Int. 2020;316:110500.
[20] Truluck CN, George CL, Hunter MD, Kusuma P, Folta KM, Speed LE, et al. Volatile losses of terpenes during post-harvest storage of cannabis. J Cannabis Res. 2023;5(1):12.



 Juli 05, 2025
Juli 05, 2025